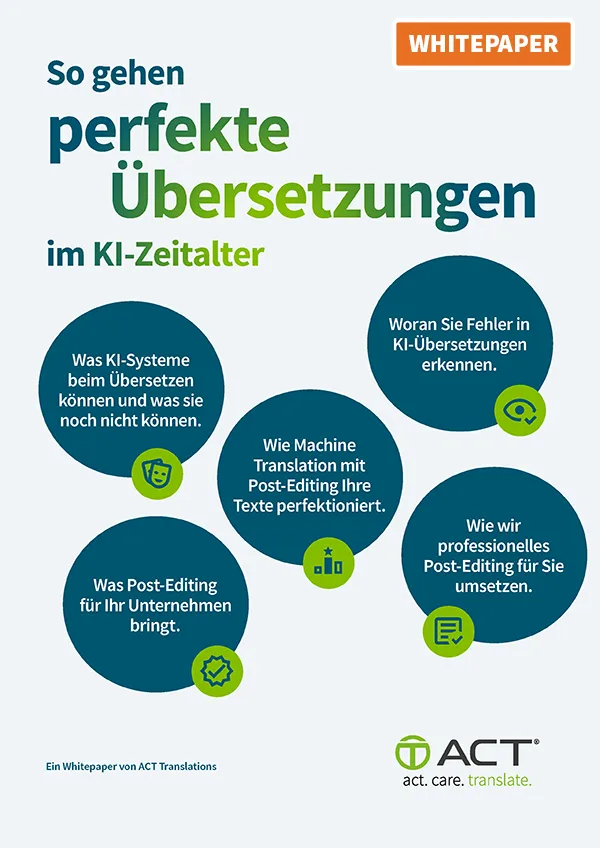Social Media ist der Inbegriff von Vernetzung und ein mächtiger Hebel im digitalen Marketing. Aber wirken die sozialen Medien überall gleich? Es gibt gute Gründe, sich die Zielmärkte sehr genau anzusehen und Social-Media-Aktivitäten dementsprechend zu lokalisieren.
Die Online-Welt könnte so einfach sein. Und gleichzeitig so langweilig. Obwohl Englisch dominiert, halten sich im Web und in Social Media hartnäckig alle Sprachen der Welt. Von Nivellierung keine Spur. Wo internationaler Austausch nicht zwingend einer gemeinsamen Sprache bedarf, kann man den Menschen einfach nicht abtrainieren, in ihrer Muttersprache zu kommunizieren. Gut so!
Dass die Sprache ein zentraler Aspekt der kulturellen Verwurzelung und des Selbstverständnisses ist, hat auch Auswirkungen auf die Marktkommunikation. Zwar sind einzelne englische Claims auch in anderen Sprachräumen wirkungsvoll, doch im Grunde setzen Marketing und Werbung überall auf die jeweilige Landessprache.
Die Sprache der Zielgruppe und des Markts sprechen
Fast 9.000 Menschen in 29 Ländern Europas, Asiens, Nord- und Südamerikas hat CSA Research und Kantar vor einigen Jahren zu ihren Präferenzen beim E-Commerce in verschiedenen Branchen befragt. Die wichtigsten Ergebnisse:
- 76 % der Menschen bevorzugen Produktinformationen in ihrer eigenen Sprache. 65 % nehmen dafür sogar in Kauf, dass die Übersetzung schlecht ist.
- 73 % der potenziellen Kunden und Kundinnen möchten zumindest Produktbewertungen in ihrer Sprache lesen.
- 75 % der Befragten betonen, dass sie auch einen Kundendienst in Landessprache erwarten. Selbst unter jenen, die im Englischen sattelfest sind, liegt der Wert noch bei 60 %.
- 40 % der Verbraucher:innen kaufen trotz bester Verkaufsargumente prinzipiell nichts auf Websites in anderen Sprachen als ihrer eigenen. Interessanterweise liegen die Deutschen mit 57 % hier an der Spitze der Umfrage.
Beeindruckende Zahlen – doch gelten sie auch für Social Media?
Muss Content unbedingt englisch sein?
Es scheint, als wäre die überwiegende Nutzung von Englisch teilweise eher der „Marktmacht“ der Lingua Franca geschuldet als dem Wunsch der User:innen. Dass sich die Menschen in ihrer eigenen Sprachwelt sicherer fühlen, zeigt eine Studie aus den USA: Tweets in spanischer Sprache zum Beispiel erzielen demnach ein um 30% höheres Engagement als solche in Englisch. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die vielen US-Hispanics Spanisch bevorzugen, obwohl sie überwiegend auch Englisch sprechen.
Social-Media-Kampagnen unter der Forscherlupe
Die Dominanz des Englischen kann den Blick darauf verstellen, dass Sprache auch in Social Media viel mehr ist als ein Tool für den Informationsaustausch. Begreift man Sprache als fundamentalen Träger von Kultur, wird klar, warum es bei internationalem Social-Media-Marketing um mehr geht als nur um Übersetzung. Vor allem dann, wenn auch die Kulturräume sehr unterschiedlich sind.
Wie sehr kulturelle Eigenheiten die Nutzung Sozialer Medien beeinflussen – und was das für das Marketing bedeutet – hat eine internationale Studie eingehend untersucht. Konkret verglichen die Autor:innen das Verhalten von User:innen in individualistischen Gesellschaften – gemeint sind Westeuropa und die USA – mit jenem von Menschen, die in kollektivistischen Gesellschaften wie China oder Südkorea leben. Sie stützten sich dabei auf die sieben Dimensionen des Honeycomb-Modells von Social Media.
1. Identität: Darf ich mich vorstellen?
In den westlichen Kulturen wird Social Media vor allem für die Selbstdarstellung genutzt. Wie viel die User:innen von sich erzählen oder zeigen und mit welcher Selbstverständlichkeit sie das tun, ist manchmal durchaus erstaunlich. Ganz anders gehen chinesische, japanische oder südkoreanische User:innen damit um. Um soziale Konflikte und Gesichtsverlust zu vermeiden, verbleibt vieles hinter der Wand der Privatsphäre. Interessant ist hier auch, dass etwa chinesische WeChat-Nutzer:innen fast nie Klarnamen verwenden.
2. Kommunikation: Wie offen darf es sein?
Die direkte und tendenziell offene Kommunikation, die auf westlichen Social Media-Plattformen herrscht, hat mit Phänomenen wie Hate Speech ihre allzu bekannten Schattenseiten. In kollektivistisch orientierten Kulturen geschieht auch die Social-Media-Kommunikation eher indirekt: Die soziale Harmonie zu bewahren, ist ein hohes Gut.
3. Sharing: Öffentlich versus privat
Westliche User:innen haben oft wenig Hemmung, ihre Gedanken, Meinungen und auch privaten Umstände anderen zugänglich zu machen. In China oder Korea ist das eher unüblich: Hier sind viele Menschen in geschlossenen Gruppen unterwegs und teilen Social-Media-Inhalte nur mit der Familie oder mit Freund:innen.
4. Präsenz: Wissen, wer da ist
In den westlichen Kulturen wird der Online-Status oft bewusst verborgen. In Kulturen mit kollektivistischer Prägung ist das anders: Viele schätzen es zu wissen, wann Freunde online sind oder sich in der Nähe befinden, um soziale Interaktionen zu erleichtern.
5. Beziehungen: Was heißt hier Freundschaft?
Der Begriff „Freundschaft“ darf in den westlichen Sozialen Medien nicht allzu ernstgenommen werden. Hier ist man mit vielen Userinnen und Usern „befreundet“, die man nie im Leben gesehen hat. Fernöstliche Social Media-Netzwerke funktionieren auch in dieser Hinsicht anders: Hier werden enge, langfristige Beziehungen bevorzugt. Sich mit Fremden zu „befreunden“, ist unüblich.
6. Reputation: Die Quellen des guten Rufs
Wert hat, was Likes bekommt. Die individuelle Reputation ist in westlichen Kulturen wichtig – und bemisst sich in den Social Media-Netzwerken an den Bewertungen durch andere User:innen. Wer viele Follower:innen hat, darf sich als Expert:in fühlen. Auf der chinesischen Einkaufs-Plattform AliExpress gilt als beliebtes Produkt nur, was hohe Verkaufszahlen erreicht und gute Gruppenbewertungen erhält – Einzelbewertungen spielen dabei keine Rolle.
7. Gruppen: Eins, zwei, viele
Gruppen, wie es sie etwa auf Facebook gibt, dienen in den individualistischen Kulturen vor allem der Vernetzung mit vielen Menschen. In den asiatischen Märkten sind die Gruppen deutlich kleiner, dafür aber auch enger vernetzt. Daher sind Messaging-Apps mit Gruppenfunktionen hier auch besonders erfolgreich.
Konkrete Tipps für effektives Marketing
Die Studienautor:innen ziehen aus den sehr unterschiedlichen Zugängen zu Social Media ihre Schlüsse für die Strategien von Unternehmen: „Kulturelle Unterschiede spielen eine entscheidende Rolle in der Nutzung Sozialer Medien. Unternehmen, die diese Unterschiede berücksichtigen, können ihre internationalen Marketingstrategien effektiver gestalten. Wer in internationale Märkte expandiert, muss Social-Media-Funktionen an lokale Kulturen anpassen.“ Und sie geben Unternehmen einige konkrete Tipps:
· Strategien der Interaktion: Westliche Unternehmen setzen manchmal darauf, offene und öffentliche Diskussionen anzuregen. Gelingt diese Strategie, kann sie hinsichtlich des Markenimages und der Markenbekanntheit Gold wert sein – gelingt sie nicht, finden sich Unternehmen im schlimmsten Fall auf der falschen Seite der öffentlichen Meinung wieder und haben alle Hände voll zu tun, die Effekte wieder einzufangen. In kollektivistischen Kulturen geht es viel stärker um die persönliche Ansprache, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Die japanische Instant-Messaging-App Line ist dafür ein gutes Beispiel: Sie ermöglicht direkte Chats zwischen Brands und ihren Kund:innen.
· Influencer Marketing: Sie haben sich zu einer der stärksten Waffen entwickelt, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten: Influencerinnen und Influencer, die kraft ihrer Bekanntheit, ihrer Authentizität und Kreativität als Markenbotschafter:innen fungieren. In den westlichen Gesellschaften gewinnen dabei die Mikro- und Nano-Influencer:innen an Boden: Sie haben eine geringere Reichweite, genießen aber in ihrer spezifischen Community hohe Glaubwürdigkeit. Genau das ist Unternehmen in fernöstlichen Märkten ans Herz zu legen. Vor allem in China muss man als Marke sicherstellen, dass die Influencer:innen eng mit ihren Communities verbunden sind. Die Empfehlungen der Stars mit ihren enormen Reichweiten verpuffen hier eher.
· E-Commerce und Social Commerce: Personalisierung ist nicht ohne Grund eine Säule des E-Commerce geworden. Unternehmen, die im Web oder über Social Media ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, tun alles, um dem Zielpublikum ein möglichst individuelles Erlebnis zu bieten. Ein wenig im Schatten steht hingegen Social Commerce, also vereinfacht gesagt: der Versuch, den gemeinsamen Einkaufsbummel eines Freundeskreises zu simulieren. Genau das führt in kollektivistischen Kulturen aber potenziell zum Erfolg. Der chinesische Online-Retailer Pinduoduo macht es vor: Pinduoduo belohnt Kund:innen, die ihre Freunde und Freundinnen zum gemeinsamen Einkauf einladen, mit Rabatten.
Neue Zielgruppen ansprechen: Sprachliche und kulturelle Vielfalt sind entscheidend
Eine Werbekampagne an einen Zielmarkt anzupassen, der völlig anders tickt, ist zweifellos die hohe Schule. Doch auch innerhalb der westlichen Welt gibt es Unterschiede in der Nutzung, die man bei der Erstellung von Postings kennen sollte. Die Anpassung betrifft zunächst die Social-Media-Kanäle, die man wählt. Die Reichweiten von Facebook, LinkedIn oder Twitter sind selbst innerhalb Europas durchaus nicht einheitlich.
Einfache Übersetzung von Social-Media-Aktivitäten ist aber auch aus einem anderen Grund problematisch. Textverständnis ist stark vom kulturellen Kontext abhängig. Was Menschen als lustig empfinden, als spannend oder anregend, ist je nach Sprache und Kultur teilweise äußerst unterschiedlich. Gleiches gilt für visuelle Inhalte, denn auch das visuelle Empfinden ist kulturell beeinflusst. Unternehmen, die solche Unterschiede nicht beachten, laufen Gefahr, Kampagnen ihre Wirksamkeit zu nehmen.
Warum Übersetzung und Lokalisierung von Inhalten so wichtig sind
Angesichts der unleugbaren Bedeutung von Social Media für das Marketing ist es erstaunlich, dass der Lokalisierung hier oft kein Wert beigemessen wird. Doch gerade die ist im Rahmen einer mehrsprachigen Internationalisierung unerlässlich – und definitiv ein Job für Profis. Muttersprachliche Übersetzer:innen, die nicht nur exzellente Expertise in der Zielsprache haben, sondern auch in der jeweiligen Kultur verankert sind, kennen die viele kleinen und größeren kulturellen Nuancen und Unterschiede, die eine Anpassung der Postings verlangen. Hinsichtlich der Texte, der Hashtags, aber ebenso der gewählten Bilder.
Die meisten Unternehmen stecken viel Kreativität, Zeit und Geld in ansprechenden Social-Media-Content und durchdachtes Copywriting. Dies in neuen Märkten verpuffen zu lassen, sollten sie sich nicht leisten. Eine gut durchdachte Lokalisierungsstrategie ist daher entscheidend.