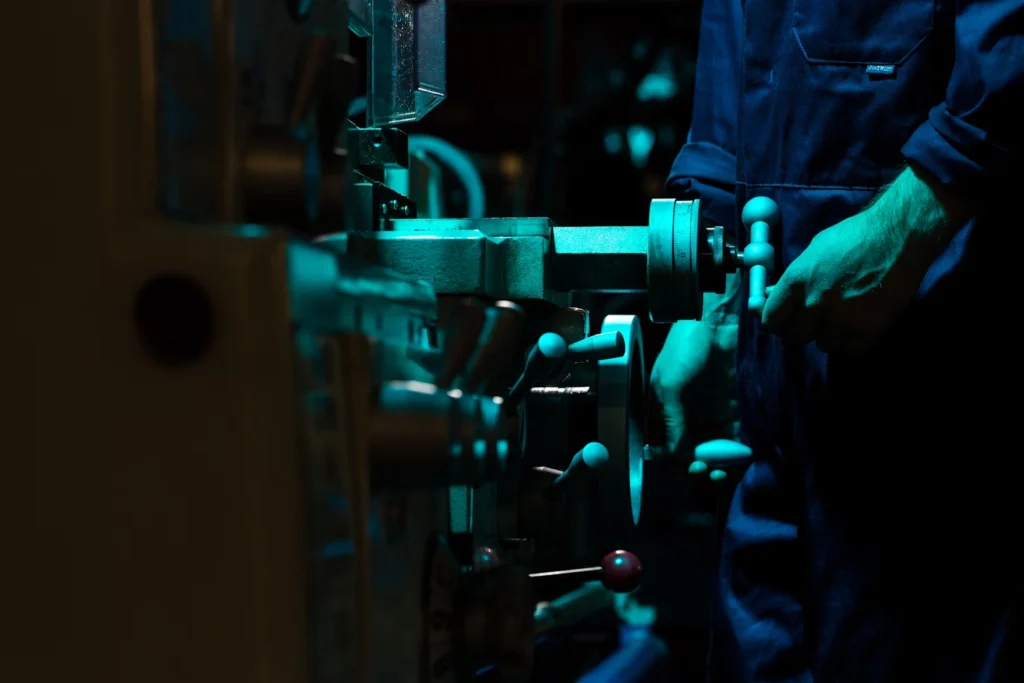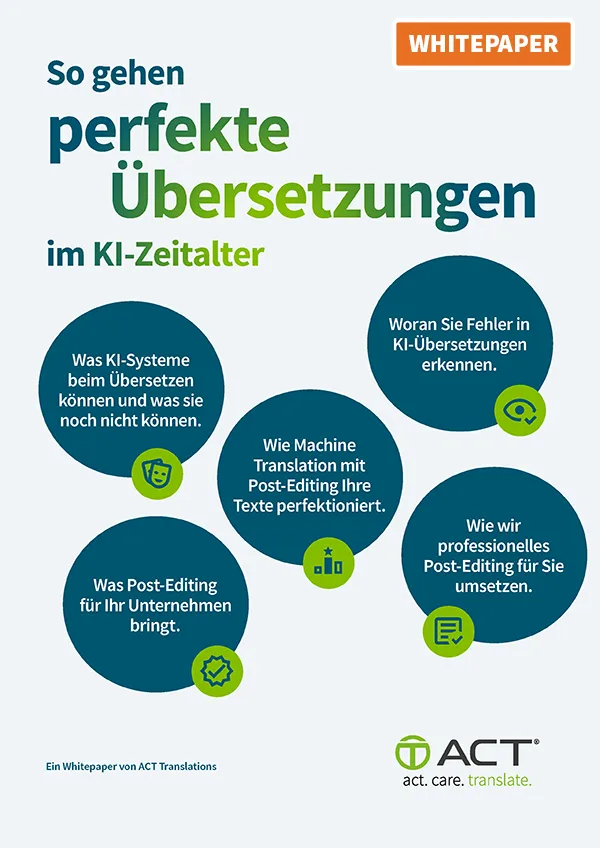Wer medizinische Texte übersetzt, übernimmt eine große fachliche Verantwortung. Die hat eine ethische Dimension, aber auch eine zutiefst juristische: Fehlerhafte oder missverständliche Übersetzungen können für Auftraggeber und Übersetzer:innen sehr unangenehme rechtliche Folgen haben.
Es waren nur einige wenige Worte, aber sie richteten immensen Schaden an. Im Jahr 2007 fiel in einem Berliner Krankenhaus auf, dass 47 Kniegelenksprothesen falsch implantiert worden waren. Auslöser für den fatalen Fehler war die englischsprachige Beschriftung der Prothesen, die vom Krankenhauspersonal falsch interpretiert wurde. Die Prothesen hätten mit Knochenzement fixiert werden müssen – waren aber im Fach für zementfreie Prothesen gelandet. In der Folge kam es zu erheblichen Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlungen.
Dass die Übersetzung medizinischer Texte in eine Zielsprache besondere Verantwortung mit sich bringt, liegt auf der Hand. Letztlich geht es ja um das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, in manchen Fällen sogar ums Überleben. Eine professionelle Übersetzung der komplexen Terminologie benötigen zum Beispiel Befunde, klinische Studien, medizinische Berichte, Beipackzettel, Handbücher für Medizingeräte und viele andere Arten von medizinischen Texten. Während falsche oder unpräzise Übersetzungen in allen Branchen unangenehme Folgen haben können, wird es im Umfeld von Medizin und Pharmazie juristisch sehr schnell ernst. Ein kompakter Überblick über die wichtigsten Rechtsmaterien, die bei medizinischen Fachübersetzungen greifen.
Zivilrecht und Medizin: Wenn schlechte medizinische Übersetzungen Haftungsfragen auslösen
Über die Frage, wann eine Übersetzung eigentlich „richtig“ ist, kann man wunderbar streiten. In der Praxis wird das Thema wohl nur relevant, wenn die übersetzte Version eines Texts zu Problemen führt. Auf zivilrechtlicher Ebene greift dann vor allem § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: die Schadensersatzpflicht. (Anmerkung: Hier, wie im Folgenden, ist die Rede von deutschem bzw. EU-Recht. Selbstverständlich gelten in allen EU-Mitgliedsstaaten ähnliche nationale Gesetzgebungen.)
§ 823 Abs. 1 lautet: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Ein Gesetz, das einerseits die Übersetzerinnen und Übersetzer betrifft, die gemäß dem Vertragsrecht für Mängel, die den vertraglich vereinbarten Erfolg gefährden, haften. Andererseits sind die Auftraggeber in der Pflicht, nach bestem Wissen und Gewissen für zuverlässige und hochwertige Übersetzung zu sorgen. Was selbstverständlich ausschließt, die Übersetzung der Sprache kundigen Mitarbeiter:innen oder gar einer Übersetzungs-KI zu überlassen.
Studie: Falsche Terminologie im Alltag
Kommt man dieser Pflicht nicht nach, droht man ins Deliktsrecht zu rutschen. Im Jahr 2010 kam eine US-amerikanische Studie diesbezüglich zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Die Autor:innen untersuchten Rezeptübersetzungen für verschreibungspflichtige Medikamente vom Englischen ins Spanische, in vielen Gegenden der USA notwendiger Alltag. 86 Prozent der Apotheken hatten laut der Studie für die Übersetzung ein Computerprogramm eingesetzt, elf Prozent eigene Mitarbeiter:innen – und nur drei Prozent professionelle medizinische Übersetzer:innen. Die Folge war eine Flut von Fehlern, Rechtschreibfehlern und falschen Formulierungen. Die Studienautor:innen kamen zu dem Schluss, dass die verschreibungspflichtigen Medikamente in diesen Fällen bei unsachgemäßer Verabreichung eher ein Gesundheitsrisiko als einen gesundheitlichen Nutzen für die Patienten darstellen, was zu Personenschäden oder sogar zum Tod führen könne.
Im deutschen Recht landet man auch bei § 823 BGB, wenn man zum Beispiel einen Befund durch KI übersetzen lässt, ohne das Ergebnis zu überprüfen oder professionell überprüfen zu lassen. Im schlimmsten Fall, bei fahrlässiger Körperverletzung oder sogar Tötung (§§ 229, 222 StGB), droht das Strafrecht mit all seinen Konsequenzen.
Das Medizinprodukterecht: Fachübersetzungen als Teil des Produkts
Auf europäischer Ebene sind die Medizinprodukte-Verordnung (MDR) und die Arzneimittelrichtlinien hoch relevant. Die MDR legt fest, dass sämtliche medizinischen Dokumente, die für Anwender:innen und Patient:innen relevant sind, in der oder den jeweiligen Amtssprachen des Landes vorliegen müssen, in dem das Produkt angeboten wird. Das betrifft zum Beispiel die Kennzeichnung, Gebrauchs- und Verabreichungsanweisungen, Implantatkarten oder sicherheitsrelevante Hinweise. Die MDR ist gewissermaßen ein weiterer Schritt der Europäischen Union, Sprache als integralen Bestandteil von Produkten zu definieren – und damit aufzuwerten.
Ein spannendes Detail: Die MDR legt auch fest, dass „die Angaben auf der Kennzeichnung (…) unauslöschlich, gut lesbar und für den vorgesehenen Anwender oder Patienten klar verständlich sein“ müssen. Es geht also um mehr als die inhaltlich präzise Übersetzung: Sie muss auch sprachlich verständlich sein. Die Verknüpfung von Sprache und Produkt hat zur Folge, dass schlechte Qualität der Übersetzung die CE-Konformität gefährden und damit Produkthaftungsansprüche auslösen kann.
Auch die Arzneimittel-Richtlinie der EU legt fest, dass Arzneimittelinformationen für Zulassungen und den Verkauf in den jeweiligen Mitgliedstaaten in der Amtssprache oder in den Amtssprachen dieser jeweiligen Staaten verfügbar sein müssen.
Die DSGVO: Wie Übersetzer:innen mit persönlichen Daten umgehen müssen
Angesichts der Sensibilität des Themas ist naheliegend, dass auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) massiven Einfluss auf medizinische Übersetzung hat. Überall, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist auch bei der Übersetzung höchste Genauigkeit gefragt. Was die Übersetzer:innen vor einige Herausforderungen stellt.
- IT-Sicherheit: Die Übersetzungen müssen im Rahmen einer sicheren IT-Infrastruktur erfolgen, um Datenlecks zu verhindern. Das kann sogar bis zu Offline-Umgebungen führen. Die Übersetzerinnen müssen jedenfalls sicherstellen, dass nur befugte Personen Zugriff auf diese Daten haben und die Übersetzungen den einschlägigen Datenschutzbestimmungen entsprechen.
- Privacy by Design: Übersetzungsdienstleister sind vertraglich verpflichtet, DSGVO-Anforderungen zu erfüllen und Vertraulichkeit zu wahren. Das bedeutet auch, dass das Thema Datenschutz von Beginn an in alle Prozesse integriert sein muss.
- Compliance: Verträge mit Übersetzungsdienstleistern müssen Datenschutzklauseln enthalten. Beide Seiten müssen entsprechende Nachweise für die Einhaltung der DSGVO bereithalten.
Die Datenschutz-Grundverordnung ist also ein weiterer guter Grund für die Medizin- und Pharma-Branche, bei der Wahl ihrer Übersetzungsdienstleister sehr sorgfältig zu sein.
Prävention: Nachweisliche Expertise, beglaubigte medizinische Übersetzungen und menschliche Fachübersetzer:innen
Juristische Probleme bei medizinischen Übersetzungen entstehen also relativ rasch. Doch es gibt probate Mittel, um das Risiko deutlich zu minimieren:
- Sorgfältige Partnerwahl: Es lohnt sich, in die Wahl des spezialisierten Übersetzungspartners ein wenig Recherche-Aufwand zu investieren. Verfügt das Übersetzungsbüro über Zertifizierungen wie ISO 9001 und ISO 17100? Gibt es Best Practices für medizinische Fachübersetzung? Gibt es glaubwürdige Empfehlungen seitens früherer Auftraggeber?
Alles über die Wahl des richtigen Übersetzungspartners erfahren Sie hier. - Beglaubigungen: Vor allem dann, wenn offizielle Dokumente Behörden vorgelegt werden müssen oder gerichtlich relevant sind, lohnt sich die Investition in eine beglaubigte Übersetzung mit Stempel und Unterschrift.
- Keine ungeprüften KI-Tools: So praktisch Künstliche Intelligenz auch sein mag – der medizinische Bereich ist viel zu heikel, um sich bei der genauen Übersetzung Ihrer medizinischen Texte allein auf ihre Fähigkeiten zu verlassen.