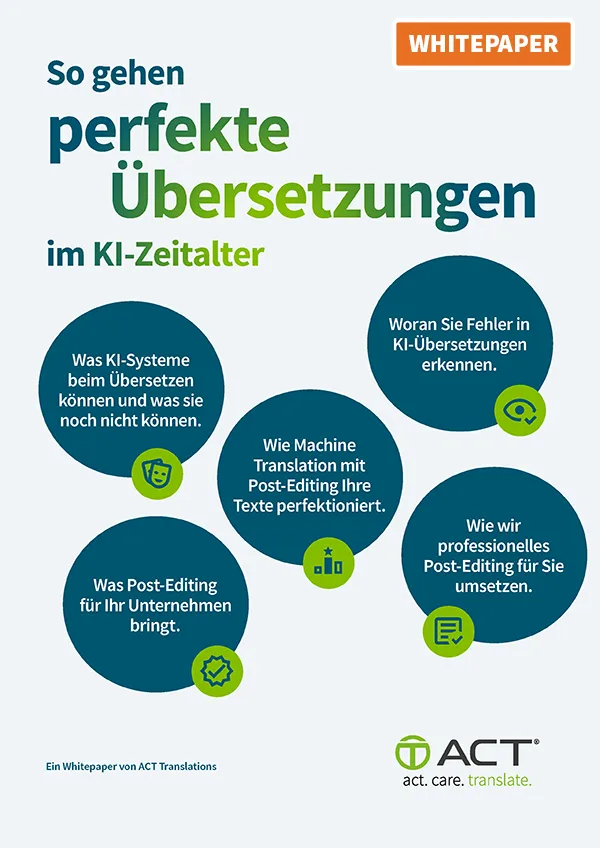Sprache wandelt sich. Das hat sie immer schon getan. Wen das irritiert, übersieht, wie wichtig Sprachwandel ist, um der Sprache immer wieder neue Lebendigkeit zu verleihen.
Titus Petronius Arbiter war ganz offensichtlich ziemlich irritiert. In seinem Roman Satyricon kritisiert der römische Dichter ausführlich das schlechte Latein der Jugend und des Pöbels. Das Vulgärlatein, das Petronius um das Jahr 50 unserer Zeit so stört, trägt bereits erste Charakteristika seines modernen Nachfolgers: der italienischen Sprache.
Rund 250 Jahre später entsteht die Appendix Probi eines namentlich unbekannten Lehrers, der akribisch auflistet, wie gewisse Vokabeln korrekt auszusprechen seien. Die Säule etwa heiße immer noch columna und nicht etwa colomna, wie man immer wieder höre. Das italienische colonna ist zu diesem Zeitpunkt also fast schon entstanden.
Sprachpuristen hat es also schon immer gegeben. Aber selbst Größen wie Arthur Schopenhauer oder Karl Kraus standen letztlich auf verlorenem Posten: Sprache verändert sich nun einmal.
Die Ursachen des Sprachwandels
Sprachwandel geschieht langsam und ist nur retrospektiv und aus gewisser Distanz zu erkennen. Und er geschieht fast immer unbewusst: Niemand hat im vierten Jahrhundert beschlossen, columna ab sofort undeutlich auszusprechen – es ist einfach passiert, und immer mehr Menschen haben es übernommen. Über lange Zeiträume hinweg können lokale Dialekte auf diese Weise zu neuen Sprachen werden.
Neben Veränderungen der Sprache aus sich selbst heraus führen auch äußere Einflüsse zum Sprachwandel. Treffen verschiedene Sprachen aufeinander, beeinflussen und verändern sie einander. Klassische Auslöser dafür sind Migrationsbewegungen, Handelsbeziehungen, kulturelle Kontakte und Austausch sowie Eroberungen und Kolonialismus. Dass die wirtschaftliche Globalisierung, Internet und Social Media sprachliche Veränderungen massiv beschleunigen, liegt auf der Hand.
Der Sprachwandel geschieht im Wesentlichen auf vier Ebenen.
#1 Erweiterung des Wortschatzes: Neue Wörter braucht das Land
Immer wieder verschwinden Wörter, und neue setzen sich durch. Im Wortschatz des ostösterreichischen Deutsch zum Beispiel waren noch vor Jahrzehnten viele jiddische und böhmische Ausdrücke gebräuchlich, ein deutlicher Nachhall der Demografie der Habsburger Monarchie. Die meisten davon sind jungen Menschen heute unbekannt. Das kann man bedauern und sich dennoch über Neuzugänge freuen.
Viele dieser Neuzugänge sind Fremdwörter und Lehnwörter, also Begriffe wie Computer oder Meeting. Sprachpuristen, die solche Einflüsse kritisieren, übersehen oft, dass es diese Einflüsse immer schon gab. Seitens des Duden heißt es, rund ein Viertel der im Wörterbuch enthaltenen Begriffe habe fremdsprachliche Wurzeln. Wobei vor allem viele, die aus dem Lateinischen und Altgriechischen stammen, längst nicht mehr als Fremd- oder Lehnwörter erkannt werden. Überraschend gering ist hingegen der Anteil von Worten aus der englischen Sprache.
Interessanterweise gab es auch gegenläufige Entwicklungen, die politische Hintergründe hatten. Schon im Barock kam es zu gezielten Versuchen, Fremdwörter durch deutsche Begriffe zu ersetzen, und im nationalistisch geprägten 19. Jahrhundert folgte ein weiterer Schub in diese Richtung. Wörter wie Anschrift (statt Adresse), herkömmlich (statt konventionell) oder Umschlag (statt Kuvert) zeugen davon.
Ein Sonderfall sind die Pseudoentlehnungen, die wie Lehnwörter wirken, ohne es zu sein. Berühmtestes Beispiel ist das Wort Handy, das im Englischen keineswegs für Mobiltelefon steht, sondern praktisch bedeutet. Manchmal überschneiden sich Pseudoentlehnung und Neologismus: Telefon zum Beispiel vereint zwei altgriechische Wörter, ohne klarerweise selbst eines zu sein.
Und schließlich kommt es immer wieder zu Neuschöpfungen, den echten Neologismen. Sie treten vor allem auf, wenn neue Lebensrealitäten benannt werden müssen. Wörter wie Livestream oder googeln konnte es früher einfach nicht geben, Klimakrise zum Glück auch noch nicht. Besonders viele Neologismen kamen immer schon aus der Jugendsprache. Und sie haben immer schon den gleichen Effekt erzielt: zunächst heftige Ablehnung seitens der Puristen, dann Etablierung einiger der neuen Wörter im Alltag.
#2 Jugendsprache und mehr: Bedeutungswandel als Treiber der Sprachentwicklung
Spannend ist der Effekt des Bedeutungswandels. Permanent werden Wörter mit neuen Inhalten aufgeladen, was ihren Sinn sowohl einschränken als auch erweitern kann. So haben etwa Begriffe wie Maus oder Surfen im Zusammenhang mit Computern und Internet ihre Bedeutung über Nagetiere und Wassersport hinaus erweitert.
Einen erheblichen Wandel hat zum Beispiel der Begriff geil durchlebt. Im Althochdeutschen hatte er die Bedeutung von übermütig, im Mittelhochdeutschen eher von kräftig, lustig oder fröhlich. Erst viel später bekam das Wort eine fast ausschließlich sexuelle Konnotation. Vor allem im österreichischen Deutsch bezeichnete geil bis vor kurzem aber auch eine sehr süße Geschmacksempfindung. Aus der Jugendsprache entstand schließlich die heute gleichberechtigte Bezeichnung für alles, das als besonders positiv oder spannend empfunden wird.
Bedeutungswandel kann auch Phrasen betreffen. Noch vor einigen Jahren passte etwas wie die Faust aufs Auge, wenn es komplett unpassend war. Das hat sich geändert: Heute ist es im Sprachgebrauch ein Bild dafür, dass etwas besonders gut passt (was übrigens auch psychologisch recht interessant ist).
#3 Der Einfluss der Dialekte: Sprachwandel durch Entwicklung der Artikulation
Die historischen Veränderungen in der Aussprache deutscher Wörter sind in der Linguistik gut erforscht. Germanistik-Student:innen können ein Lied davon singen, dass es nicht ganz einfach ist, sich die diversen Lautverschiebungen zu merken. Die Veränderungen trennen bis heute die verschiedenen deutschen Sprachräume und Dialekte.
Ein Beispiel: Ungefähr ab dem elften Jahrhundert kam es in großen Teilen des deutschen Sprachraums zur sogenannten neuhochdeutschen Monophthongierung. Dabei wurden Zwielaute zu langen Vokalen, also etwa guot zu gut oder bruoder zu Bruder. In Gegenden wie Baden-Württemberg, Bayern oder Österreich geschah das allerdings nicht. Dort werden die Wörter im Dialekt auch heute wie guat und Bruader ausgesprochen.
Was Petronius im ersten Jahrhundert so bitter beklagte, trifft also unweigerlich jede Sprache: Die Aussprache verändert sich, getrieben von Dialekten und der Alltagssprache. Unaufhaltsam und immer wieder.
#4 Die deutsche Sprache und ihre Grammatik: Sprachwandel oder Sprachverfall?
Grammatikalische Veränderungen der Sprache sind wahrscheinlich noch vor Anglizismen und Denglisch jener Aspekt des Sprachwandels, der die Gralshüter am effizientesten auf die Palme treibt. Und damit haben sie nicht ganz unrecht. Zumindest dort, wo es um sprachliche Verarmung, um die Nivellierung nach unten geht.
Der schleichende Rückzug von Genitiv, Präteritum und Konjunktiv oder das Überhandnehmen von Hilfsverben sind in der Alltagssprache kein Problem. Beim Sprechen haben Menschen schon immer dazu geneigt, Sprache möglichst einfach und effizient zu halten. Dass die verbreitete vereinfachte Kommunikation in den sozialen Medien in Kombination mit dem Rückgang des Lesens der Sprache insgesamt nicht gut tut, kann allerdings kaum bestritten werden.
Mit dem Lamento über den Sprachwandel darf man es nicht übertreiben, er ist Teil der Lebendigkeit von Sprache. Wenn allerdings Kultur verloren geht, darf man mit Recht traurig sein.
Wörterbücher: Neue Regeln als Stein des Anstoßes
Angesichts der sprachlichen Entwicklungen wirken Wörterbücher ein bisschen wie Staumauern, die permanent neue Risse bekommen. Man kann vermuten, dass die beiden Brüder Jacob und Wilhelm Grimm so etwas wie Endgültigkeit schaffen wollten, als sie im Jahr 1838 die Arbeit am gigantischen Deutschen Wörterbuch begannen. Als der letzte Band ganze 123 Jahre später fertiggestellt war, hatten die zuvor erschienenen allerdings bereits bedeutende Überarbeitungen erfahren.
Und der erste Band der Duden-Reihe, das Rechtschreibwörterbuch, löst mit jeder neuen Auflage heftige Kritik aus, speziell angesichts des Versuchs, dem Sprachwandel gerecht zu werden. Immer wieder dreht sich der Disput um Anglizismen, Neologismen und Jugendsprache, um gendern und vor allem um grammatikalische Neuerungen. Der Musikwissenschaftler und Kunstgeschichtler Manfred Sack ging 1985 in einem lesenswert wütenden Text in Die Zeit mit seiner Kritik besonders weit.
Das Thema Sprachwandel ist ein hoch emotionales mit einigen negativen, aber gleichzeitig vielen positiven Entwicklungen.