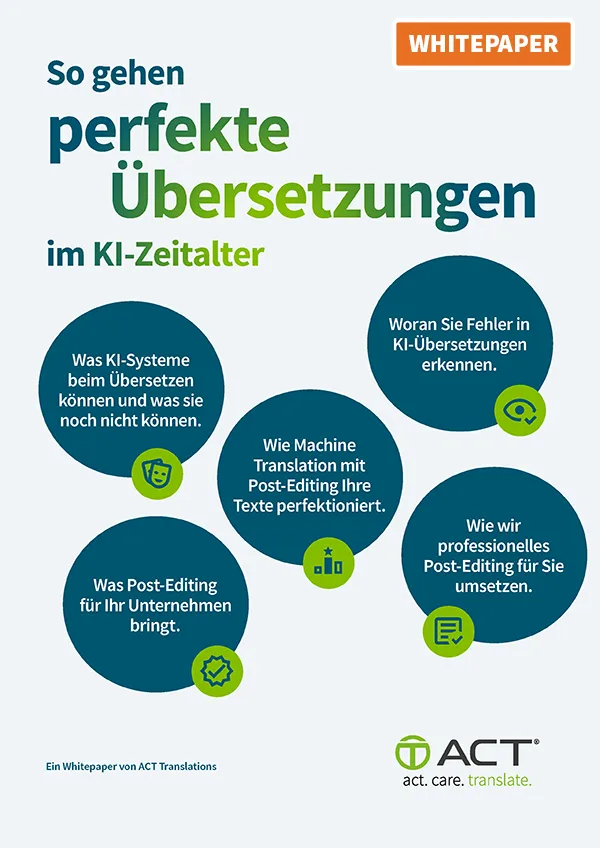Die Entschlüsselung ausgestorbener Schriftsysteme gehört zum Spannendsten, das die Sprachwissenschaft zu bieten hat. An der Schnittstelle zwischen Archäologie und Linguistik ist es immer wieder zu legendären Durchbrüchen gekommen.
Auf den Durchbruch folgt die Ohnmacht. Als Jean-François Champollion am 14. September 1822 nach jahrelanger ermüdender Arbeit begreift, dass er die ägyptischen Hieroglyphen tatsächlich entziffern kann, läuft er zu seinem Bruder, ruft „Je tiens l’affaire!“ („Ich habe es geschafft!“) und bricht bewusstlos zusammen.
Die von mehreren Zeugen bestätigte Anekdote ist heute ebenso legendär wie die sensationelle Leistung des französischen Sprachwissenschaftlers. Er hatte es gegen zahlreiche Widrigkeiten und Rückschläge geschafft, was lange für unmöglich gehalten worden war.
Grundlage seines Erfolges war der berühmte Stein von Rosette, der heute im British Museum ausgestellt ist. 1799 wurde er von Soldaten des napoleonischen Ägypten-Feldzugs gefunden (und geraubt) und geriet nach dem Sieg der Briten über Frankreich 1801 nach London. Das Stelen-Fragment zeigt einen Text in ägyptischen Hieroglyphen sowie die Übersetzung in die ägyptische Alltags-Schrift Demotisch und ins Altgriechische. Das war die Grundlage für Champollions späteren Erfolg.
Der Krimi um die Hieroglyphen zeigt exemplarisch, was zusammenspielen muss, um vergessene Schriften zu entschlüsseln: akribische Arbeit, unglaubliche Ausdauer – und das Glück, einen Bezugspunkt zu finden. Die Sprachwissenschaft ist voll von solchen Geschichten. Hier sind drei der spannendsten.
Linearschrift B: Ein Meilenstein für Linguistik, Archäologie und Geschichte
Arthur John Evans hat viel gemeinsam mit seinem großen Vorbild, dem Troja-Entdecker Heinrich Schliemann. Als Autodidakt wird er oft nicht ernstgenommen, er setzt archäologische Grabungstechniken ein, die Fachleuten die Haare zu Berge stehen lassen, er ist stur und arrogant. Und er ist letztlich erfolgreich. Nach hartnäckiger Recherche findet Evans im Jahr 1900 auf Kreta die Ruinen von Knossos und damit den ersten Beleg für die Existenz der minoischen Hochkultur.
An einem jedoch scheitert Evans: Die auf zahlreichen Tontäfelchen gefundene völlig unbekannte Schrift (er nennt sie Linearschrift B) kann er trotz intensiver Versuche bis zu seinem Lebensende nicht entziffern. Das liegt einerseits daran, dass er anderen keinen Zugang zu seinen Funden erlaubt. Andererseits ist er auf der völlig falschen Spur: Evans ist davon überzeugt, dass Linear B die isolierte Sprache der Minoer darstellt, also eine nicht-indogermanische Sprache, für die es keinerlei Bezugspunkt gab.
So bleibt es bis in die 1940er-Jahre. Dann gelangt der Nachlass von Evans in die Hände der US-amerikanischen Altphilologin Alice Elisabeth Kober. Ihr gelingen zwar große Schritte zum Verständnis der Schrift, doch auch sie erkennt nicht, was sie da wirklich vor sich hat.
Das gelingt erst dem englischen Architekten und Linguisten Michael Ventris im Jahr 1952. Er kommt als erster auf die Idee, Linear B könnte eine frühe Form der griechischen Sprache sein. Indem er in den Texten nach heute noch gleich oder ähnlich lautenden kretischen Ortsnamen sucht, schafft er den Durchbruch.
Inhaltlich sind die Texte übrigens nicht besonders aufschlussreich. Es handelt sich um belanglose Notizen aus Verwaltung und Handel, die rein zufällig erhalten sind, weil die Tontäfelchen bei Bränden dauerhaft gebrannt wurden. Die Auswirkungen auf die Geschichtswissenschaft sind wesentlich spannender: Die Entzifferung von Linear B machte klar, dass schon in der mykenischen Kultur Griechisch gesprochen wurde.
Zwei weitere kretische Schriftsysteme bleiben bis heute rätselhaft: An Linear A und der kretischen Hieroglyphenschrift sind bislang alle Entzifferungsversuche abgeprallt.
Eine ausgezeichnete Dokumentation über die Entschlüsselung der Linearschrift B finden Sie auf YouTube.
Keilschrift: Entzifferung im Teamwork
Die Keilschrift ist ein Schriftsystem, das in mehreren Sprachen Verwendung fand. Die sumerische Version ist fast 5.500 Jahre alt und damit neben den ägyptischen Hieroglyphen die älteste heute bekannte Schrift.
Die völlige Fremdartigkeit der Schrift macht sie buchstäblich über Jahrhunderte zu einem ungelösten Problem. Schon 1621 zeigt sich der römische Forschungsreisende Pietro della Valle von der Inschrift auf einem in Persepolis gefunden Ziegel fasziniert. Die Entzifferung ist kein plötzlicher wissenschaftlicher Durchbruch, sondern ein Prozess, der ein halbes Jahrhundert dauert. Und ein Erfolg, der mehrere Väter hat.
Den Anfang macht der deutsche Altertumsforscher Georg Friedrich Grotefend, der als erster postuliert, dass es sich bei Keilschrift überhaupt um Schriftzeichen handelt. Im Jahr 1802 gelingt Grotefend, in Abschriften eines Texts die Königsnamen Darius und Xerxes zu identifizieren. Damit ist das Fundament gelegt.
Und darauf bauen Wissenschaftler wie Christian Lassen, Henry Creswicke Rawlinson, Edward Hincks oder Jules Oppert Schritt für Schritt auf. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Behistun-Inschrift auf einem Felsen im Gebiet des heutigen Iran. Wie der Stein von Rosette ist auch sie eine Trilingue: Der Text, in dem sich König Dareios I. ausführlich selbst preist, liegt in Altpersisch, Elamitisch und Babylonisch vor. Nachdem Rawlinson das altpersische Schriftsystem entziffert hat, sind auch die beiden komplexeren Keilschriften kein Problem mehr.
Zum großen Finale kommt es in London, und es klingt wie ein Roman-Abschluss von Jules Verne. Da immer noch Zweifel bestehen, ob die Schrift nun tatsächlich korrekt entschlüsselt sei, versendet die Royal Asiatic Society die Abschrift eines neu entdeckten assyrischen Texts in versiegelten Umschlägen an vier Koryphäen: an den englischen Archäologen und Linguisten Henry Creswicke Rawlinson, den englischen Fotografen und Universalgelehrten William Henry Fox Talbot, den irischen Ägyptologen und Assyriologen Edward Hincks und den deutsch-französischen Altorientalisten Jules Oppert. Die vier, die nichts von dem Test wissen, liefern der Society schließlich weitgehend übereinstimmende Fassungen. Am 25. Mai 1857 verkündet die Kommission das offizielle Ergebnis des „Great Cuneiform Decipherment Test“: Das Rätsel ist gelöst.
Hethitisch: Also doch indogermanisch?
Die Entschlüsselung der hethitischen Sprache stellt die Forschung vor ein anders geartetes Problem. Ab den 1890er-Jahren werden in Anatolien erste Tontafelfragmente gefunden, die eindeutig dem Hethiter-Reich zuzuordnen sind. Verfasst sind sie in einer Variante der Keilschrift. Die Forscher:innen können die Schrift also lesen, aber leider nicht verstehen, da die Sprache selbst unbekannt ist.
Die Lösung des Rätsels gelingt, ähnlich wie im Fall von Linearschrift B, indem man etablierte Meinungen infrage stellt. Bis hat in der Forschung die Hypothese gegolten, Hethitisch sei keine indogermanische Sprache. Daran kommen schon ab 1902 erste Zweifel auf, aber erst im Jahr 1915 kann der tschechische Linguist Bedřich Hrozný das Gegenteil beweisen. Im ersten Satz, den Hrozný übersetzen kann, wird das sichtbar: „Ihr esst Brot, Wasser aber trinkt ihr.“, „NINDA-an ēzzateni, wādar-ma ekuteni.“ Das althochdeutsche ezzan und das altniederdeutsche watar sind deutlich zu erkennen.
Wer wissen möchte, wie Hethitisch (wahrscheinlich) geklungen hat, erfährt es in diesem YouTube-Video.