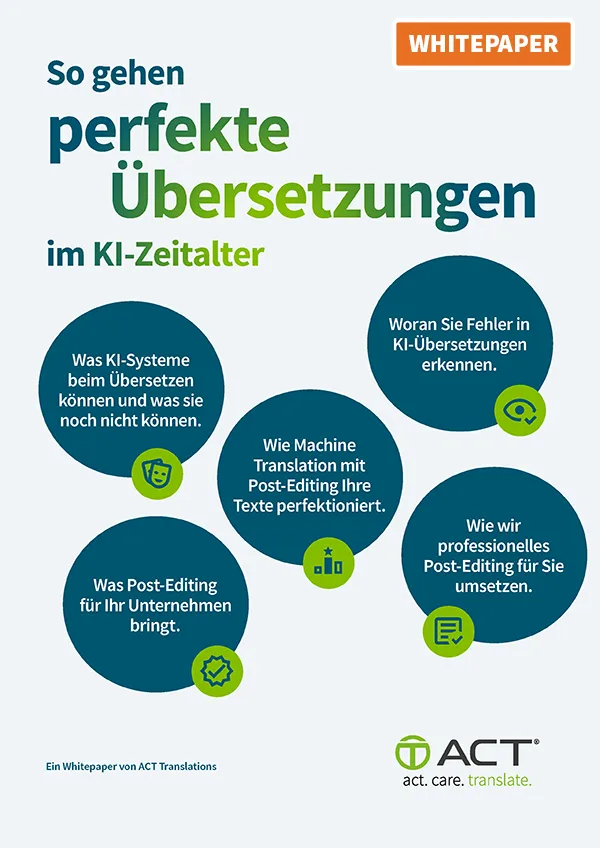Juristische Dokumente müssen vor allem eines leisten: Durch klare Formulierung jeden Spielraum der Interpretation verhindern. Das führt nicht nur zu eigentümlicher Prosa, es gelingt auch nicht immer. In vielen Fällen ist es eine ungenaue Übersetzung, die diesen Spielraum eröffnet. Und das kann fatale Folgen haben.
Manche Fehler wurden rechtzeitig entdeckt. Andere haben Unternehmen schwer beschädigt oder sogar zu Krieg und Zerstörung geführt. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wie viel Schaden schlechte oder unklare Übersetzung von juristischen Texten wie Verträgen, Gesetzen oder anderen Dokumenten anrichten kann. Hier sind zehn besonders markante Fälle.
#1 Wenn schlechtes Übersetzen Freihandel verhindert
Im Jahr 2011 scheiterte ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea an der schlechten Übersetzung eines Vertrags. Dafür gab es genau 207 Gründe – so viele Übersetzungsfehler wurden in der koreanischen Version gefunden. Eine koreanische Zeitung listete einige davon auf: Aus „Transplantation“ etwa war „Transfusion“ geworden. „Epidemiologie“ war zu „Hautpflegedienst“ mutiert. Es gab auch Fälle, in denen Elemente in der Übersetzung ausgelassen oder nach Belieben hinzugefügt worden waren. In sieben Fällen wurde das Wort „any“ in negativen Sätzen ausgelassen. Der Text enthielt außerdem 16 koreanische Grammatikfehler. Die Zeitung wies auch mit Freude darauf hin, dass ein externer Spezialist umgerechnet 27.503 US-Dollar für die Dienstleistung der finalen Überprüfung erhalten hatte. Das Fazit des Journalisten: „Die meisten der Fehler entsprachen nahezu dem Englisch von Anfängern.“
#2 Ein kleines Wort stiftet politische Unruhe
Am Ende musste sogar der Außenminister ausrücken, um zu erklären, was passiert war. Im August 2008 hatte die französische Regierung unter Präsident Nicolas Sarkozy einen Friedensplan vorgelegt, der den sogenannten Kaukasuskrieg zwischen Russland und Georgien beenden sollte. Frankreichs Außenminister Bernard Kouchner räumte im September ein, dass es darin zu mehreren Übersetzungsfehlern gekommen war, wobei vor allem einer davon zu erheblichen diplomatischen Problemen führte: In der russischen Version des Textes war von der „Sicherheit Abchasiens und Südossetiens“ die Rede, während dies in der englischen Version, die dem georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili übermittelt worden war, als „Sicherheit in Abchasien und Südossetien“ dargestellt wurde. Ein winziger Fehler, der die Intention des Friedensplans komplett veränderte und für heftigen Ärger zwischen den beteiligten Parteien sorgte.
#3 Ein Übersetzungsfehler für 760 Millionen Dollar
Ein Fall aus dem Jahr 2006 illustriert, welche finanziellen Dimensionen fehlerhaft übersetzte Terminologie annehmen kann. Ecuador hatte eine Beteiligung der texanischen Ölgesellschaft Occidental Petroleum enteignet, damit aber gegen eine Vereinbarung verstoßen und musste daher Schadenersatz leisten. Zwar einigten sich beide Seiten, aber aufgrund schlechter juristischer Übersetzungen aus der ecuadorianischen Rechtsprechung ins Englische wurde der Occidental zugesprochene Schadenersatz um 40 % (oder 760 Mio. USD) erhöht. Auslöser war die Frage, ob der Begriff „solemnidades“ als „rechtliche Anforderungen“ oder als „formale Erfordernisse“ zu übersetzen sei. Zwar wurde die 40 %-Erhöhung letztlich annulliert, doch allein die Kosten für die Verfahren waren enorm.
#4 Der Vertrag, der nicht zustande kam
Die Sportgeschichte ist voll von Übersetzungsfehlern – angesichts der Internationalität kein Wunder. Die meisten Fails sind durchaus lustig, doch manchmal können sie auch gravierende Folgen haben. Etwa für den ecuadorianischen Fußballprofi Bryan Cabezas: Der sollte 2018 von Atalanta Bergamo an den argentinischen Club Independiente verliehen werden. Zwar waren sich alle Seiten einig, aber der Transfer platzte dennoch: Die Vertragsübersetzung war offenbar maschinell durchgeführt worden, und das machte aus Bryan Cabezas – durchaus konsequent – Bryan Heads. Womit Vertrag und Transfer leider Makulatur waren.
#5 Ein Rechtssystem, zwei Terminologien, viele Rechtstexte
In Ländern mit zwei oder mehreren Amtssprachen können auch Gesetzestexte aufgrund von Übersetzungsfehlern zu Problemen führen. Ein bekanntes Beispiel lieferte das bilinguale Kanada, wobei der Fehler offenbar entdeckt wurde, ehe er Schaden anrichten konnte: In der englischen Fassung eines Gesetzes aus dem Strafrecht war von „sexual assault“ die Rede, also von sexuellem Übergriff oder Nötigung. In der französischen Fassung verwendeten die Übersetzer:innen allerdings den Begriff „attentat à la pudeur“, was eher so viel wie „unanständiges Verhalten“ bedeutet. Ein kleiner Fehler, der in der strafrechtlichen Praxis zu völlig unterschiedlichen Interpretationen oder sogar Urteilen hätte führen können.
#6 Juristische Übersetzung in der EU: Dienstleistung in 24 Sprachen
Noch komplizierter wird es auf der Ebene des EU-Rechts, da hier jeder amtliche oder juristische Text in sämtlichen Amtssprachen der Union veröffentlicht werden muss – aktuell immerhin stolze 24, was die Übersetzer:innen gut beschäftigt. Ein bekanntes Beispiel für mangelhafte Übersetzung betraf ein Formular zum Europäischen Nachlasszeugnis. Darin wurde der englische Begriff „heir“, also „Erbe“, in der spanischen Version als „albacea“ übersetzt. Das ist allerdings der Testamentsvollstrecker, womit die Rechte und Pflichten im Falle eines Nachlasses völlig anders verteilt wurden. Auch dieser Fail wurde mittlerweile behoben.
#7 Ein einzelner Übersetzer vernichtet ein Volk
Ob dem englischen Missionar Henry Williams ein Irrtum unterlief, oder ob er bewusst irreführend übersetzte, konnte nie geklärt werden. Die Folgen waren jedenfalls katastrophal. Am 6. Februar 1840 schlossen das Vereinigte Königreich und das Volk der Maori den Vertrag von Waitangi, der dem neuseeländischen Volk unter anderem Sicherheit und den Schutz seines Eigentums versprach. Laut der englischen Version sollten die Maori „ihrer Majestät, der Königin von England, absolut und ohne Vorbehalt alle Rechte und Befugnisse der Souveränität abtreten“. In der Version für die Maori war lediglich von den Regierungsrechten, nicht aber von Souveränität die Rede. Nicht zuletzt infolge dieses Vertrages kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Enteignungen und letztlich dem Verlust der kulturellen Identität eines ganzen Volkes. Der Vertrag von Waitangi gilt als eine der verheerendsten politischen Fehlübersetzungen der Geschichte.
#8 Übersetzung von Verträgen: Wer spricht für den Kaiser?
Und noch ein Vertrag, der alles andere als Frieden brachte: Am 2. Mai 1889 schlossen Italien und Abessinien (das heutige Äthiopien) den Freundschaftsvertrag von Wuchale. Die italienische Version des Vertrages besagte, dass statt des abessinischen Kaisers fortan Italien für die Repräsentation Abessiniens gegenüber anderen Staaten zuständig sei – ein klassisches Protektorat also. In der Version für Kaiser Menelik II. las sich das anders: Hier hieß es lediglich, dieser könne sich durch Italien vertreten lassen, er müsse es aber nicht. Auch in diesem Fall ist nicht bekannt, ob der Übersetzer aus Absicht oder mangelndem Verständnis der rechtlichen Begrifflichkeiten handelte. 1896 kam es im Rahmen des ersten italienisch-äthiopischen Krieges zur Niederlage der Italiener in der Schlacht von Addis Abeba. Und damit war auch der unselige Vertrag Geschichte.
#9 Warum man den Finanzbericht professionell übersetzen lassen sollte
Als das Unternehmen den Fehler bemerkte, war der Schaden schon angerichtet. Im Jahr 2012 veröffentlichte der Elektronikkonzern Sharp einen Finanzbericht mit negativem Cashflow. Sharp betonte in der japanischen Originalversion jedoch, dass es „keine Zweifel am Fortbestand des Konzerns“ gebe. In der englischen Version des Berichts war allerdings von „erheblichen Zweifeln“ die Rede. Zwar erfolgte die Korrektur sehr rasch, doch das Unternehmen bekam den Geist nicht mehr in die Flasche. Innerhalb eines Tages fiel der Aktienkurs um zehn Prozent, und auch der Imageschaden war gewaltig.
#10 Fachübersetzungen machen Politik: Kalter Krieg mit Übersetzungsfehlern
In Zeiten großen Misstrauens sind Präzision und korrekte Formulierungen in Rechtstexten wie völkerrechtlichen Verträgen besonders wichtig. Als am 24. Oktober 1945 die Charta der Vereinten Nationen in Kraft trat, war der Kalte Krieg nur noch wenige Jahre entfernt. In Artikel 51 des Dokuments heißt es: „Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung (…)“ In früheren russischen Versionen trat der Aspekt des individuellen Rechts auf Selbstverteidigung allerdings hinter jenes auf kollektive Verteidigung zurück. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Sowjetunion traditionell auf kollektive Maßnahmen und die Zustimmung durch den Sicherheitsrat pochte, war der Unterschied in der russischen Zielsprache bedeutsam. Kompliziert wurde die Debatte vor allem durch Artikel 111 der UN-Charta, wonach die fünf offiziellen Sprachversionen – Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch (später auch Arabisch) – im Streitfall gleiche Gültigkeit besitzen. Maximale Genauigkeit und Beglaubigung durch ein professionelles Übersetzungsbüro erhalten auf dieser Ebene tatsächlich geopolitisches Gewicht.